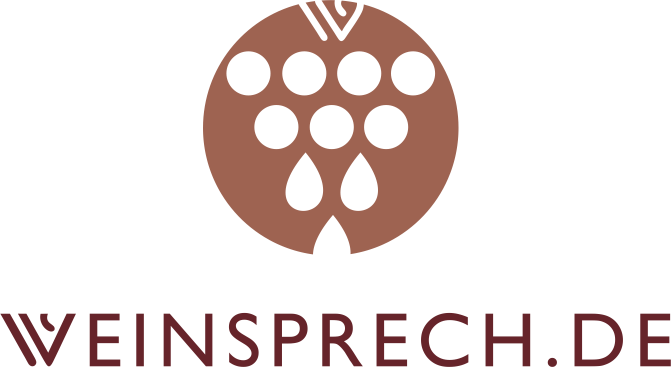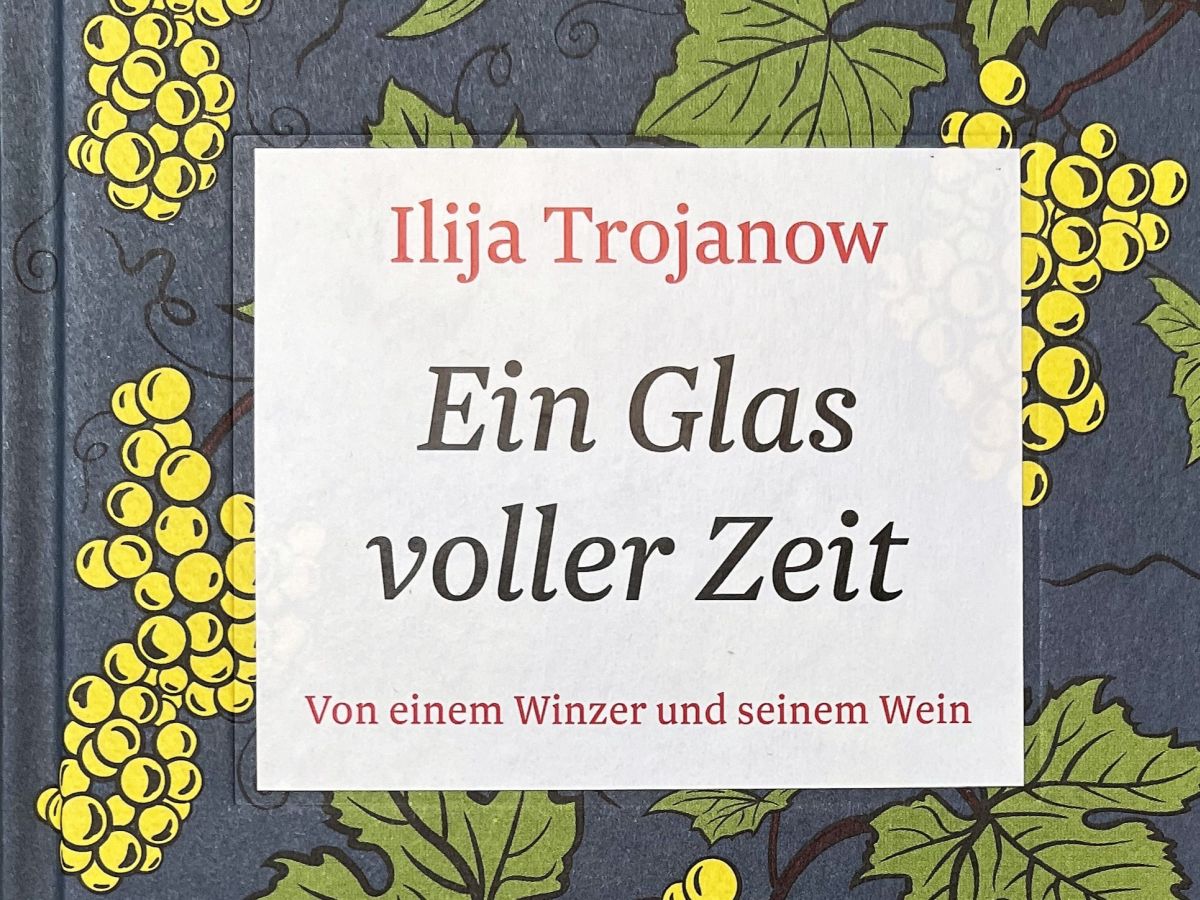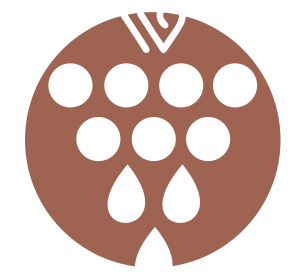Romancier Trojanow äußert sich in einem essayistisch gehaltenen Bändchen über Wein und das Winzern. Wenn man sich einmal an den Stil gewöhnt hat, legt man es nicht mehr weg.
Man weiß am Anfang von Ein Glas voller Zeit, nicht recht, welche Art von Buch einen hier erwartet. Daher sei vorweggenommen: Es ist eine Hommage an den Wein, an hervorragende Weinberge und Winzer. Und das Lesen bereitet in seinem Verlauf zunehmend Gewinn und Genuss.

Stilistische Herausforderung
Dies geschieht in einem nicht immer ganz zugänglichen Stil. Man wird zwar im Prolog vorgewarnt: „Wein betört den Gaumen, Poesie die Gedanken. Mehr an Unterscheidung wäre übergriffig. Aufgelesen, ausgelesen.“ Aber manchmal ist es dann doch zu viel des poetischen Stils und der gehobenen Wendungen à la „Wein im Zeitalter seiner technologischen Reproduzierbarkeit“. Zumindest in einem Band, der – trotz des Untertitels, der etwas anderes nahelegt – über weite Strecken eine Streitschrift darstellt.
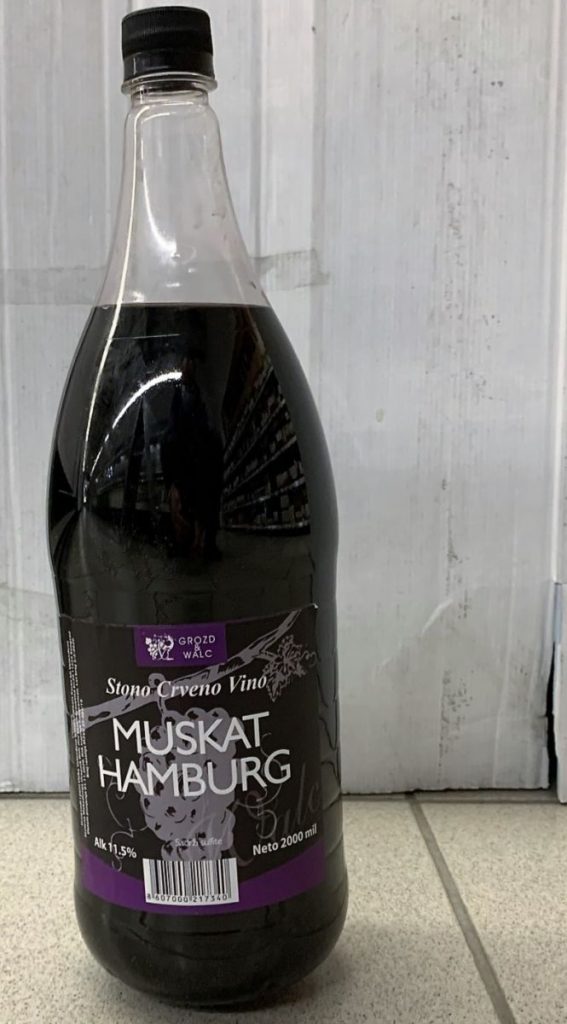
Außerdem wirkt das Buch teilweise auch wie ein Parforceritt durch die Höhen und Tiefen des deutschen und internationalen Weinbaus: Sweet-and-Cheap-Welle, Weingesetz von 1971, Glykol-Skandal auf der einen, terroirbetonte Rieslinge auf der anderen Seite. Wer das ausbuchstabiert und nicht nur sarkastisch angerissen haben möchte („Und Zeno, der das Glas gekonnt schwenkte und das „Bouquet“ einatmete wie das Parfüm einer unwiderstehlichen Verführerin, verkündete stets verlässlich: „Ein feiner Tropfen.“ Später erfuhr ich vom Glykolskandal.“), wird woanders fündig werden. (beispielsweise hier)
Sesshaftigkeit wegen Wein
Auch recht steile Thesen, wenn auch mit unscharfem Bezug auf „manche Wissenschaftler“, werden aufgestellt: „Der Mensch sei sesshaft geworden, um einen kontrollierten Zugang zur Weinproduktion zu gewinnen“. Trotzdem eine reizvolle Behauptung!

Gerade heutzutage im Zeitalter der großen Kritik am Alkohol, bei der der Wein häufig einfach Bier, Schnaps und Alkopops beigeordnet wird. Trojanows weitere Ausführung der These – und indirekte Antwort auf die aktuelle scharfe Kritik am Weingenuss – bleibt seinem Stil treu: „Um zu trinken. Nicht Alkohol, sondern Nektar“. Auch wem das eine Nummer zu groß erscheint: Weingenuss erscheint hier bedenkenswert, nicht nur bedenklich.
Ist Wein-Marketing statthaft?
Und tatsächlich sind viele Aussagen Trojanows bedenkenswert. Zum Beispiel seine Kritik an Storytelling und Marketing. Dabei lehnt er sich in diesem Fall aus dem Fenster, indem er nicht einfach allgemein drauflos kritisiert, sondern auch Namen nennt, und durchaus keine kleinen: etwa Markus Molitor und seine Domäne Serrig.

Natürlich sind Formulierungen wie die „Wiederbelebung einer Legende“ und die „Renaissance des deutschen Rieslings“ – er zitiere von „einer Webseite“, zumindest auf der des Weinguts findet sich dies nur teilweise wieder – äußerst pompös, andererseits gehört das eben zum Verkaufen hinzu, gerade in diesen für den Wein schwierigen Zeiten.
Trojanow schreibt weiter: „Topwinzer sind zu Markenbotschaftern der eigenen Philosophie geworden.“ Hier wird Molitor dann doch und zu Recht als Top-Winzer bezeichnet. Bemerkenswert ist bei all der Marketingkritik, dass das Wort Philosophie nicht in Anführungszeichen steht, dabei ist dieser Begriff im Zusammenhang mit Weingütern doch genau das.
Kapitalismus und Biodynamie
Ein bisschen wohlfeil auch die Kapitalismuskritik: „Im Kapitalismus, erst recht in seiner digitalisierten Form des marktschreierischen Dauerlärms, klingelt Quacksalberei verlässlich in der Kasse.“ Mag ja sein. Aber gleichzeitig bedeutet das eben auch Freiheit, nämlich genau das zu kaufen, was man möchte. Unabhängig davon, wie andere es finden und ob sie es besser wissen oder nicht.

Über einen Kamm lässt sich der Autor jedoch ganz und gar nicht scheren. Wer bei diesem kapitalismuskritischen Ansatz denkt, er betreibe Systemkritik in alle üblichen Richtungen, irrt. Die Biodynamie, gerne als ganzheitlich und sich der Gewinnmaximierung entziehend dargestellt, lehnt er vehement ab. Rudolf Steiner wird als schwierige Person mit teils unmöglichen Positionen dargestellt und zurecht daran erinnert, dass dieser Alkohol grundsätzlich ablehnte, was angesichts der sich auf Steiner berufenden Winzer kurios erscheint.
Bessere Weine wegen oder trotz Biodynamie?
Außerdem stellt Trojanow dar, dass viele der sich als biodynamisch gerierenden Winzer sich doch nur bedienen an einem unscharfen Sammelsurium an Praktiken und Einstellungen. Seine Schlussfolgerung lautet: „Weswegen die Biodynamik so typisch ist für unsere Epoche: Aus einem Bedürfnis nach nachhaltiger Weinwirtschaft, aus einer Sehnsucht nach einer ganzheitlichen Herangehensweise, entspringt ein Sammelsurium verschrobener Alternativen.“

Sicherlich nicht ganz falsch. Auch hier schert er nicht alles über einen Kamm, sondern erkennt an, dass einige nun biodynamisch arbeitende Winzer bessere Weine machen würden als vor der Umstellung. Und nennt auch mögliche Gründe, etwa den gesteigerten Respekt gegenüber Boden und Natur.
Spritzen unumgänglich
Modernen Praktiken steht er aufgeschlossen gegenüber, solange sie nicht bloß auf rein technische Machbarkeit abzielen, etwa das Aromatisieren mit Holz-Chips. Kaliumphosphonat (im Band noch Phosphorige Säure genannt) etwa, dem ewigen Zankapfel des Bio-Weinbaus, bringt er keine Ablehnung entgegen. Auch nicht dem Spritzen generell.
Vielmehr verteidigt er es, weil es nun einmal nötig sei, angesichts der eingeschleppten Pilzkrankheiten. Und verteidigt dies auch gegen militante Kritiker wie den deutschen Schmetterlingsverein, der für das Aussterben des Apollo-Falters als „monokausale Erklärung“ das Ausbringen von Fungiziden mittels Hubschrauber ins Feld führe.

Das Dilemma zwischen Natur und Kultur reißt der Autor zumindest an, bezeichnet das „Verschwinden eines Schmetterlings in unseren Breiten als Phantomschmerz“, sagt aber im gleichen Absatz, dass „in einem verwilderten Weinberg das Gestrüpp alles andere überwuchert und die existierende Vielfalt erstickt“.
Reinhard Löwenstein als Angelpunkt
Als zwar nicht einzige, aber immer wiederkehrende Quelle Reinhard Löwenstein (Weingut Heymann-Löwenstein, Mosel) anzugeben, wirkt vielleicht etwas einseitig.

Aber das Bändchen gibt sich eben nicht als beschreibendes Sachbuch, sondern als persönlicher Blick auf die Dinge. Und offenbar hat der Winzer den Autor nachhaltig beeindruckt, immerhin ist ihm augenscheinlich das Buch gewidmet („Für Reinhard“), der Untertitel weist wohl auf ihn hin (Trojanow: Ein Glas voller Zeit. Von einem Winzer und seinem Wein). Gleichwohl lernt man über Löwenstein Dinge hinzu, die man eventuell nicht wusste, etwa dass er das Nachhaltigkeitssiegel Fair and Green mit ins Leben gerufen oder dass er den Begriff der Terrassenmosel geprägt haben soll.
Vielleicht ist er Löwenstein, den er im Text schlicht Reinhard nennt, aber auch ein wenig zu sehr erlegen. Etwa, wenn er ihn anscheinend in einem eigenen Absatz, kursiv gedruckt, ohne weitere Einleitung, zitiert: Terroir ist, wenn der Winzer sagt: Ich mache nicht Riesling, ich erwecke den Uhlen. Ist das nicht die Art von „Philosophie“, die der Autor als Marketinggeschrei diffamiert?
Unterkomplexe „Werbesprache“?

Auch im weiteren Verlauf des Bandes prangert er wiederholt „die Werbesprache“ an: „Schwammige Begriffe wie „intensiv“, „harmonisch“, „komplex“ oder „ausgewogen“ gaukeln Präzision vor.“ Auf der nächsten Seite aber schreibt er, dass „die weltweiten Pop-Hits musikalisch immer weniger Komplexität aufweisen“. So schwammig kann der Begriff des Komplexen also doch nicht sein – auch nicht beim Wein. Bezeichnet er in der Sommelier-Sprache doch das Vorhandensein mehrerer Aromen, bestenfalls aus mehr als einer der drei verschiedenen Aromengruppen.
So definiert Trojanow Ein Glas voller Zeit

Durchaus interessant auch Trojanows zum Titel passenden Überlegungen, die er gleich am Anfang des Buches ausführt. Beispiel: „Jeder Schluck Terrassenriesling gewährt eine sinnliche Ahnung von urzeitlichen Meeresablagerungen. Wie schmecken Mineralstoffe, die sich über Jahrmillionen in den Schichten des Schiefers abgelagert haben. Diese Zeittiefe ist keine intellektuelle Behauptung, sondern eine unmittelbare flüssige Erfahrung.“ Wie wahr. Und eine ureigene Dimension von Wein, Zeit und Zeitabläufe nicht nur zu konservieren, sondern erlebbar zu machen.
Erkenntnisse aus der Sensorikforschung
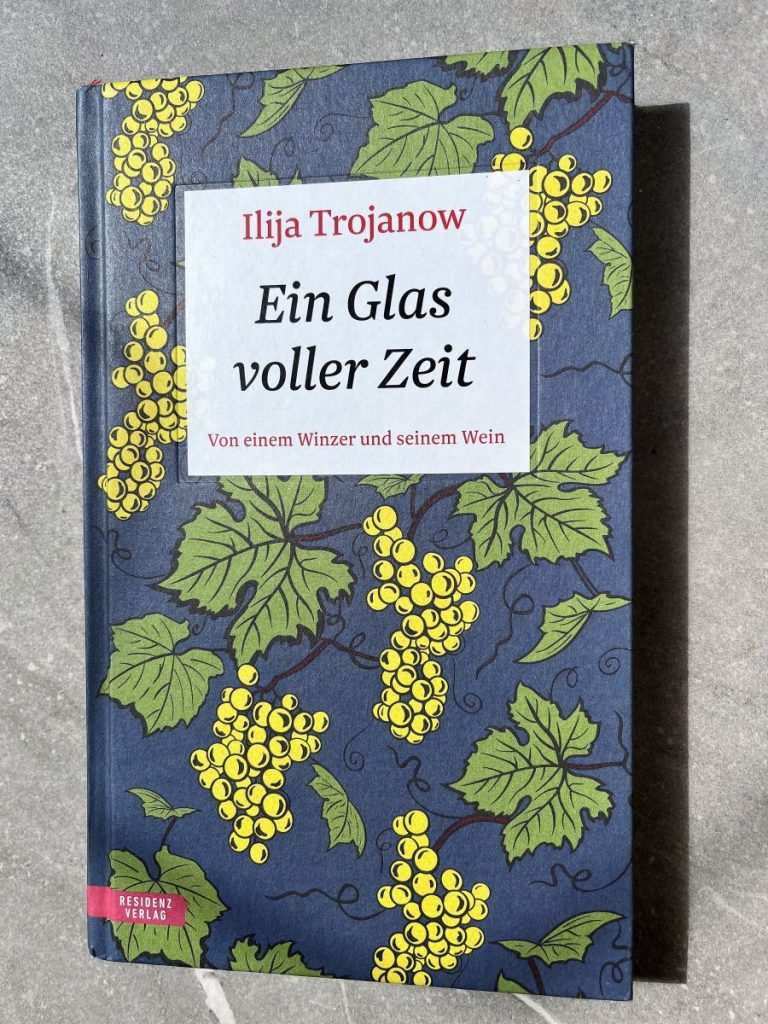
Auch im Kapitel Geschmack von Ein Glas voller Zeit plaudert Trojanow über persönliche Erfahrungen, streift mit einem erzählenden „Wir“ dabei aber auch Erkenntnisse der Sensorik-Wissenschaften. Etwa die Verschränkung von Situation und sensorischer Wahrnehmung, aber auch die hereinspielenden physiologischen Bedingungen, zum Beispiel weniger Speichelfluss bei Erschöpfung und dadurch veränderte Wahrnehmungsmöglichkeiten.
Oder auch die Feststellung, „die Phänomene, die wir sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken – auch wenn sie eigenständig existieren –, sind in der Form, in der wir sie erfahren, Konstruktionen unseres Gehirns“. Das ist gerade im Zeitalter von KI und elektronischen Sommeliers eine wichtige Erkenntnis.
Man erfährt auch womöglich noch nicht Gehörtes, zum Beispiel dass es nun einen sechsten Geschmackssinn geben soll: „Kokumi, ein gewisses Gefühl der Mundfülle“.
Auge geht vor Ohr
Manchmal muss man auch schmunzeln, zum Beispiel wenn anscheinend ein Zitat von Saint-Exupéry abgewandelt wird: „Wir riechen nur mit dem Hirn gut.“ Auch wenn es natürlich stimmt, denn Geschmacks- und Geruchseindrücke ergeben zusammen mit weiteren Faktoren, zum Beispiel optischen, ein gesamtsensorisches Bild, vulgo den Geschmack, idealerweise den Genuss.

Einige sensorische Erkenntnisse werden auch gelungen knackig zusammengefasst: „Wenn das Sehen dem Schmecken widerspricht, setzt sich das Auge durch.“ Denn „ein roter Smoothie ist leckerer als ein grüner, selbst wenn beide die gleichen Ingredienzen enthalten.“
Bei diesem Kapitel merkt man, dass der Autor sich durchaus in den wissenschaftlichen Stand der Dinge eingelesen hat. Etwa wenn er sagt: „Je nachdem, welche Musik läuft, ändert sich unser Schmecken.“
Das heißt nicht, dass alle seine Ausführungen nachvollziehbar wären: „Und wenn wir von „blumig“ sprechen, meinen wir eigentlich „obstig“, doch da das Wort im Deutschen nicht existiert, klettern wir auf den falschen Ast…“ Soll das heißen, florale Noten im Wein gebe es nicht?
Seltsame Abneigung gegenüber Sommeliers

Man muss auch nicht jede Meinung teilen, zum Beispiel die offensichtliche Abneigung des Autors Sommeliers gegenüber: „Wenn sich mal wieder ein Sommelier an ihrem Tisch aufmandelt, erinnern Sie ihn doch daran, dass seine Berufsbezeichnung höchstwahrscheinlich vom altprovenzalischen Wort saumier abstammt: jemand, der Lasttiere belädt“. Man kann die Sprache von Sommeliers ungewöhnlich oder manchmal etwas drüber finden, muss dabei aber nicht ihre Aufgabe negieren. Beispielsweise die des Vermittlers oder Anregenden, sowohl den Gästen als auch den Winzern gegenüber, wie es etwa Daniel Deckers in einem ebenfalls dieses Jahr erschienenen Band treffend dargestellt hat.

In dem Zusammenhang heißt es auch: „Aber könnte es sein, dass gerade jene, die sich enorm angestrengt haben, ihren Geschmack zu verfeinern, die unmittelbare Freude, die unbändige Lust an der Gustation verlieren?“ Auch wenn auf diese rhetorische Frage wohl keine Antwort erwartet wird, muss sie doch Nein lauten.
Laut Residenz-Verlag ist der Autor selbst Sommelier, was in dem Zusammenhang erstaunt. Allerdings findet sich diese Information weder in der Biografie des Autors noch auf Wikipedia.
Was dagegen immer durchscheint, ist, dass Trojanow Romancier ist. Hat man sich erst einmal an den essayistischen Stil von Ein Glas voller Zeit gewöhnt, möchte man den Band nicht mehr weglegen – und bekommt Lust auf die nächste Weinprobe.
Ilija Trojanow: Ein Glas voller Zeit. Von einem Winzer und seinem Wein. Salzburg 2025. 18 Euro.