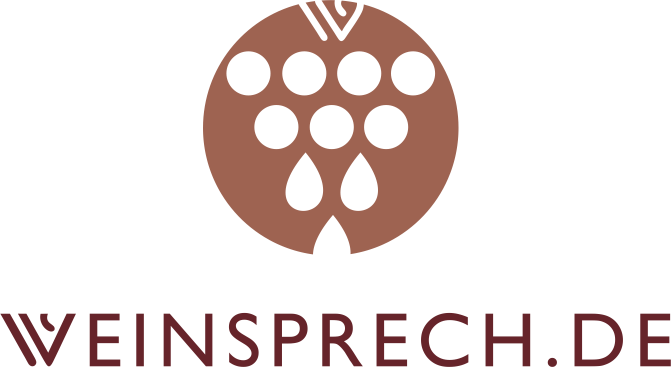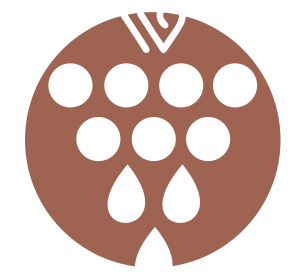Wie es dazu kam, dass man heute so gut speisen und trinken kann wie vielleicht nie zuvor: Nach dem Wirtschaftswunder setzte laut Josef Matzerath und Daniel Deckers „Das deutsche Küchen- und Weinwunder“ ein.
Rustikal, mit großen Portionen: In den Jahren des Deutschen Wirtschaftswunders herrschte die „Sättigungsküche“ vor. Ab den 1950er Jahren gönnte man sich gelegentlich auch Hawai-Toast oder ein Hähnchen in einer der Wienerwald-Filialen. Und ab den 1970er Jahren setzte sich „fremdes Essen“ in der Gastronomie durch, beim „Italiener um die Ecke“. Das versprach etwas mehr Kulinarik und war bei vielen Menschen beliebt durch das familiär-vertraute Ambiente. Die Hochküche dagegen wurde von vielen, nicht zuletzt durch den eleganten Service, als distanziert wahrgenommen und misstrauisch beäugt. Von einem Küchen- oder Weinwunder konnte da noch kaum die Rede sein.

Die Sterne leuchteten noch nicht
Während man heute mit einer gewissen Selbstverständlichkeit über Spitzenköche und das Auf und Ab der Sternegastronomie berichtet, so war das vor rund einem halben Jahrhundert noch anders. Wann und wie sich die deutsche Hochküche Ende des letzten Jahrhunderts wieder bildete, von wem sie lernte und wie sie sich emanzipierte, das erfährt man im ersten Teil des neuen Sachbuchs „Das deutsche Küchen- und Weinwunder“, verfasst von Josef Matzerath. Im zweiten Teil widmet sich dann Daniel Deckers Fall und Wiederaufstieg des deutschen Weins (hier springen Sie direkt dorthin). Gleichzeitig bildet das Buch den ersten Band einer neuen Reihe von Studien zur „Kulinarischen Ästhetik“, herausgegeben vom transcript-Verlag.
Jenseits von Sättigung und Gemütlichkeit

Bereits am Anfang wird die These aufgestellt, „dass sich in der Ästhetik der exquisiten Küche die gesellschaftlichen Gegebenheiten der jeweiligen Zeit spiegeln.“ Das erscheint plausibel und damit auch der langsame Aufstieg der Hochküche hierzulande, je weiter das Wirtschaftswunder voranschreitet und Freiräume bildet, in denen sich ein Bedürfnis oberhalb von Sättigung und Gemütlichkeit bildet. Gleichzeitig blieb der Genuss um seiner selbst willen etwas Neues, das dementsprechend erklärungsbedürftig war: Selbst „Auberginen waren noch so unbekannt, dass Witzigmann sie auf seiner deutsch-französischen Karte mit Eierpflanze übersetzte.“ Und man schaute nach Frankreich und importierte Feinschmecker-Produkte vom Pariser Großmarkt. Immerhin: 1966 vergab der Guide Michelin die ersten Sterne in West-Deutschland. Die Kriterien seien damals weniger streng gewesen. Für viel Aufsehen sorgte der Guide hierzulande erst einmal nicht. Die begehrteste Auszeichnung zu Beginn der 1970er Jahr sei die „Goldene Pfeffermühle“ gewesen!
Die Linke und die Kulinarik

Trotz der zarten Veränderungen blieb die Spitzenküche lange alles andere als gesellschaftlich akzeptiert. „In einem kleinen Kreis von Wirtschaftsführern“ entwickelte sich Interesse, Politiker blieben lange skeptisch. Symptomatisch dürfte, auch wenn in diesem Band nicht erwähnt, das große Misstrauen Helmut Schmidts gewesen sein: „Der Wein ist mir egal, das Essen ist mir auch egal“, soll er gesagt haben und die Ansprüche der Protokollchefs hinsichtlich der Speisen- und Weinauswahl teils als „größenwahnsinnig“ kritisiert haben. (siehe Rezension: „Mit Wein Staat machen“). Erst als in den 1990er Jahren auch die „linke Szene“, so wieder Matzerath, sich für Kulinarik zu interessieren begann, war das Thema gesellschaftlich akzeptiert. Rückblickend äußerte sich etwa Joschka Fischer lobend über die kulinarische Öffnung, die Wolfram Siebeck mitverursacht habe.
Wolfram Siebeck als Wegbereiter

Und Siebeck wird überhaupt als Star der deutschen Gastronomie-Kritik, geradezu als ihr Erfinder dargestellt. Und tatsächlich erschienen seine Texte viele Jahre eben nicht nur in Spartenmagazinen wie „Feinschmecker“, sondern etwa auch in Der Zeit oder im Stern. Vielleicht übertreibt es Matzerath mit dem Raum ein wenig, dem er dem Kritiker einräumt, indem er sogar eine Liste von Zitaten abdruckt, in denen Siebeck gewürdigt wird.
Überrascht liest man, dass auch der „Playboy“ regelmäßig Restaurant-Kritiken veröffentlichte. Heute dagegen wird mit Selbstverständlichkeit in den allgemeinen Medien ausführlich über Genuss-Themen berichtet. Was sich ebenfalls seit den 1990er Jahren geändert habe, sei die „Top-down-Kommunikation“ bei Kulinarik, die mit dem Aufkommen des Internet noch stärker ins Hintertreffen geraten ist. Das muss man unbedingt begrüßen und dürfte nicht unerheblich zur Demokratisierung des Genusses beigetragen haben.

Der Sündenfall Bocuse‘
Einiges aus der damaligen Zeit erinnert sicher auch an heute, etwa die Selbstvermarktung der Star-Köche. Wer hätte gewusst, dass Bocuse für Dosensuppe geworben hat? Das sorgte bei deutschen Küchenchefs für einen Aufschrei. Diesen vermisst man heute eher, wenn man sich anschaut, für wie viele fragwürdige Produkte manche bekannten Köche ungeniert werben. Wobei das Problem das alte ist: Während im eigenen Restaurant mit Frische und Saisonalität geworben wird, sieht dies bei den beworbenen Produkten oft ganz anders aus. Apropos Spitzenköche: Neben der raumgreifenden geschichtlichen Darstellung der Kochkunst gibt es auch eine kurze Darstellung der Stile heutiger Spitzenköche. Damit zeigt der Band auch einen Servicegedanken.

Das Primat des Produkts stand zwar auch am Anfang der bundesrepublikanischen Hochküche, doch ab den späten 1980ern musste es nicht mehr hochexklusiv und weit gereist sein. Sicher dauerte es noch eine Weile, bis man nicht mehr Hummer und Kaviar mit Spitzenküche verband, sondern ausgezeichnete Produkte aus der näheren Umgebung, etwa Steinpilze statt Trüffel. Eine gute Entwicklung.
Top-Küche ja, Sommelier nein
Aus heutiger Sicht fast unglaublich scheint außerdem, dass in den Anfangszeiten noch keine Sommeliers in den hochrangigen Restaurants arbeiteten. Da musste der Gast noch richtig Ahnung haben, damit er eine Flasche bestellen konnte, die möglichst auch noch zu verschiedenen Gängen passte. Sommelier-Lehrgänge nahmen erst in den 1980er Jahren an Fahrt auf. Heute sind Weinbegleitungen, mit einem passenden Glas Wein zu jedem Gang, Usus in der Hochgastronomie.

Der erste Teil des Buches endet ziemlich plötzlich, ohne Fazit, was schade ist. Wer sich für Kulinarik interessiert, wird die Ausführungen bereichernd finden. Auch wer sich nicht intensiv für Geschichte interessiert, wird nach der Lektüre die Erscheinungen der heutigen Spitzenküche mit anderen Augen sehen und anders wertschätzen.
Lesen Sie hier die Rezension des Weinwunders