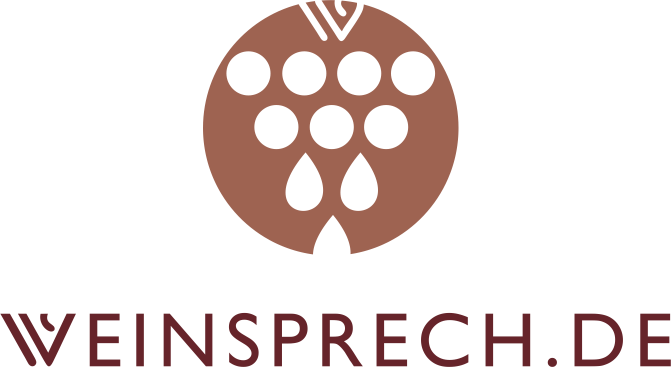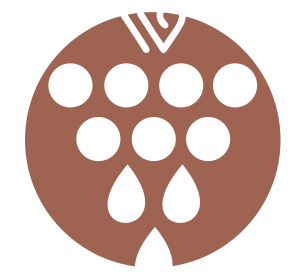Ein Glas auf den 200. Geburtstag des französischen Dichters: Wein ist bei Baudelaire ein Mittel der Inspiration. Wie er schmeckt, erfährt man in seinen Texten nicht.

Der französische Dichter Charles Baudelaire war ein großer Verehrer des Weins. Einen ganzen Teil des Gedichtzyklus‘ „Les Fleurs du Mal“ (Die Blumen des Bösen) hat er ihm gewidmet. Doch womit stößt man auf seinen 200. Geburtstag an? Wein ist bei Baudelaire Wein. Ob Rot oder Weiß, Burgund oder Bordeaux, erfährt man nicht. Und auch sein Geschmack wird nicht thematisiert. Erschreckend zudem, dass bei Baudelaire Wein kaum als Genuss-, sondern vor allem als Rauschmittel verstanden wird. Trotzdem alledem ist seine Darstellung sympathisch. Woran liegt das?
Hier spricht der Wein
Im Gedicht „Die Seele des Weins“ kommt der Wein selbst zu Wort. Er spricht, nein er „singt in den Flaschen“. Davon, dass er sich der Mühe bewusst ist, die der Winzer mit ihm hatte: „Mühe, Schweiß und kochende Hitze“. Wo hat man das schon gesehen, dass ein Flaneur-Dichter sich in den harten Alltag der arbeitenden Bevölkerung hineindenkt? Auch ein erschöpfter Werktätiger wird im weiteren Verlauf aufgeführt, in dessen „heißer Brust“ der Wein sein „sanftes Grab“ finden wird – und das viel schöner findet als seinen „kalten Keller“. (alles eigene Übersetzungen, außer den Textstellen aus dem Essay)
Schoppen oder Kulturgetränk

Was danach kommt, müsste man wahrscheinlich heute mit einem Warnhinweis versehen. Dort verspricht der Wein dem Zecher nämlich zufriedene Sonntage, ein Glänzen in den Augen seiner Frau, seinem Sohn Kraft und Farbe. Na ja. Aber danach wird wieder klar, was das alles soll. Der Wein bezeichnet sich nämlich als „vom ewigen Sähmann ausgeworfenes wertvolles Korn“, das sich mit dem fröhlichen Zecher verbindet: „Damit aus unserer Liebe die Poesie hervorgeht, die zu Gott wie eine seltene Blume emporsteigt.“ Wer singt da nochmal? Die Seele des Weins! Es geht also doch nicht nur um den sonntäglichen Schoppen, sondern um das Kostbare in diesem Kulturgetränk. Für Baudelaire ist das die Inspiration.
Schlummer oder Wein?
Offenbar ist für Baudelaire Wein ein Mittel, das der Mensch selbst geschaffen hat, um über sich hinauszuwachsen. So wird es auch im darauffolgenden Gedicht, „Der Wein der Lumpensammler“, dargestellt. Gott, so heißt es dort, habe aus Schuldgefühlen gegenüber den Elenden den Schlaf als Mittel der Linderung geschaffen. „Der Mensch fügte den Wein hinzu, den heiligen Sohn der Sonne!“ So erhebt sich auch der humpelnde und an den Häuserwänden abstützende Lumpensammler aus seinem Elend, „legt seinen Eid ab, diktiert erhabene Gesetze […] und ergötzt sich am Glanz seiner eigenen Wirkungskraft.“ Wie der Schlaf, ist auch dieser rauschhafte Höhenflug nur vorübergehend. Aber immerhin, will uns Baudelaire wohl sagen.
„Das Haschisch ist nutzlos und gefährlich“
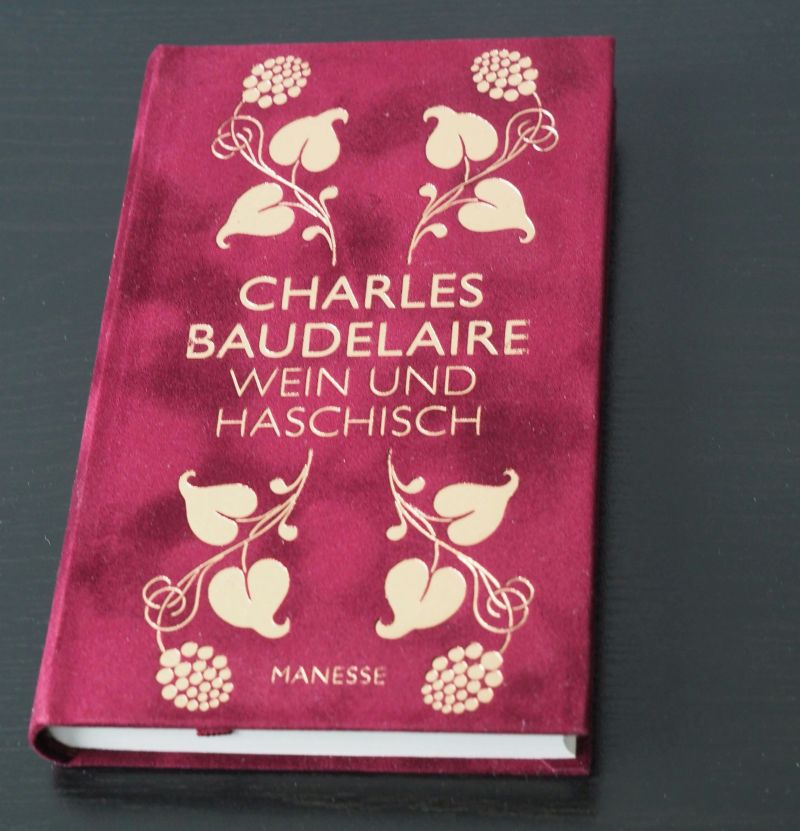
Bemerkenswert ist jedoch, dass bei Baudelaire Rausch nicht einfach Rausch ist. Nur wenn dieser etwas aus seiner Sicht Nützliches hat, wird er für ihn interessant. Ziemlich nüchtern wägt er daher die Wirkung von Wein und Haschisch gegeneinander ab. Sein Urteil über das Haschisch ist eindeutig: Es hat für die Realität keinen Nutzen, macht passiv und einsam. „Der Wein hingegen ist zutiefst menschlich.“ Damit ist das gemeinsame Erleben, der Austausch und das Schöpferische gemeint – etwa wie der Lumpensammler sich rhetorisch zum Juristen emporschwingt. So nachzulesen in dem Essay-Bändchen „Baudelaire, Wein und Haschisch“, in deutscher Sprache erschienen im Manesse-Verlag.
Hat bei Baudelaire Wein nur Vorteile?

Denn nicht nur in seinen Gedichten, auch im Essay preist Baudelaire Wein überschwänglich: „Wie großartig sind die Schauspiele des Weins im strahlenden Licht unserer inneren Sonne! Wie glühend und echt fühlt sich die zweite Jugend an, die der Mensch aus ihm schöpft!“ Und natürlich ist manches davon schwer erträglich, klingt es doch wie die Verharmlosung von Alkoholismus: „Alle Tage wiederholt er [der Wein] seine Wohltaten.“ Auf den impliziten Vorwurf erwidert er ausweichend: „Ich muss gestehen, dass ich angesichts der Wohltaten [des Weins] nicht den Mut aufbringe, die Schäden zu zählen.“ Dass er diese kennt, scheint an anderer Stelle zumindest durch: „Der Wein ist dem Menschen vergleichbar: Man kann nie wissen, inwieweit man ihn achten oder verachten, ihn lieben oder hassen wird und zu welchen erhabenen Taten oder entsetzlichen Untaten er fähig ist.“
Das Ungeheuer trank nicht
Unheimlich wird es dem Leser, wenn Baudelaire von einem Künstler schreibt, der eine fotorealistische Abbildung schwirrender Fliegen gemalt hat. Dieses „Abscheuliche“ lässt ihn Nachforschungen über den „moralischen Charakter“ des Urhebers anstellen: „Ich erfuhr, dass das Ungeheuer regelmäßig vor Tagesanbruch das Bett verließ, seine Haushälterin zugrunde gerichtet hatte und nichts anderes trank als Milch!“ Dem Leser nach 1945 fällt da noch eine andere Person ein. Enthaltsamkeit allein ist nicht der Schlüssel zum Guten, da hat Baudelaire sicher recht. Wie immer pointiert heißt es bei ihm: „Wer nur Wasser trinkt, hat vor seinen Mitmenschen etwas zu verbergen.“
Baudelaire, Wein und Musiker

Viel hilft viel, das mag man bei Wein sicher nicht behaupten. Bei Baudelaire sieht das anders aus. In einer seiner Anekdoten, die er in dem Essay erzählt, wächst etwa ein „bis zur Besinnungslosigkeit betrunkener“ Gitarrist über sich hinaus: „Die Gitarre […] plaudert, sie singt, sie deklamiert mit geradezu erschreckendem Schwung und einer unerhörten Sicherheit und Reinheit des Klangs.“ Zumindest aus der Gegenwart fallen einem dagegen Beispiele ein, bei denen alkoholisierte Musiker künstlerisch gar nicht mehr zu überzeugen wussten. Immerhin muss Baudelaire zugeben, die Geschichte nur aus zweiter Hand zu kennen: „Ein Zeuge, an dessen Ernst und Aufrichtigkeit nicht zu zweifeln ist, hat mir die Sache berichtet.“
Ganz im Außen, ganz bei sich
Bei dem Dichter selbst verlief es im Übrigen anders als bei dem Gitarristen aus der Anekdote, der im Rausch über sich hinauswuchs. In „Mon cœur mis à nu“ (Mein Herz, offen gelegt) schreibt Baudelaire: „Die Entgrenzung und die Konzentration des Ich. Darin findet sich alles.“ Wenn man diesen Satz poetologisch liest, heißt das: Der Dichter, „der sich Genie antrinkt“, kann diese Entgrenzungs-Erfahrungen allenfalls dann verwerten, wenn er wieder bei sich ist. „Und wenn der Winter mit seinem monotonen Schneefall kommt, schließe ich überall Türen und Fensterläden, um in der Nacht meine feenhaften Paläste zu errichten,“ heißt es im Gedicht „Landschaft“ aus den Blumen des Bösen.
Trunkenheit ohne Wein

Wein ist anscheinend nur ein Mittel unter vielen, um Entgrenzungserfahrungen zu machen. Denn wie übersetzt man das Prosa-Gedicht „Enivrez-vous“? Wörtlich mit: Betrinkt euch? Oder besser: Werdet trunken? Denn betrinken kann man sich nur mit Alkoholika, trunken werden lässt sich auch an anderem. „Um nicht die furchtbare Last der Zeit zu spüren, die eure Schultern brechen lässt und euch zur Erde beugt, müsst ihr pausenlos trunken sein. Aber wovon? Von Wein, Dichtung, Tugend, wie es euch beliebt. Aber werdet trunken.“
Bei aller Begeisterung, die Baudelaire Wein zollt, bleibt dieser bei ihm ein generisches Getränk. Aber er war kein Sommelier, sondern Dichter. Vor 200 Jahren wurde er in Paris geboren.
(Buchbesprechung: Kulturgeschichte der französischen Küche)