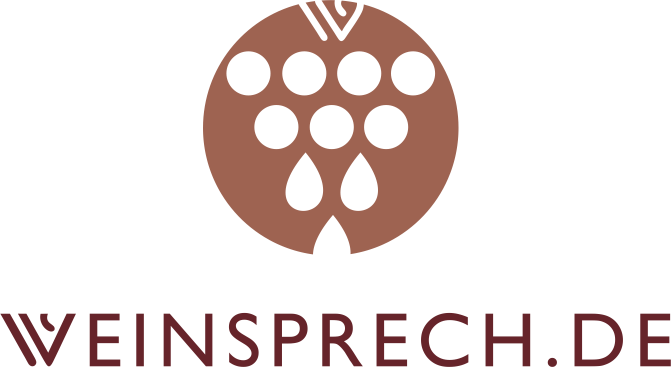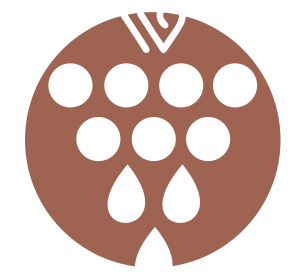Mit dem Taxi im Libanon von Weingut zu Weingut
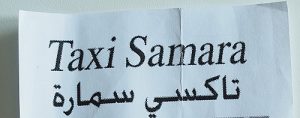
Im Libanon Weingüter besuchen, so lautet der Plan. So where do we go?, möchte Samara, der Taxifahrer unseres Vertrauens, wissen. Die Kellerei heißt Clos du Phoenix und liegt in Eddé. Er schaut irritiert. Ah!, ruft Samara dann aus, Eddé! Stimmt, so wie er es ausspricht, den Wortanfang kräftig behaucht – arabisch eben –, klingt es schon anders. Er kennt sich in der Gegend nicht so gut aus und Hinweisschilder sind nicht gerade Legion. Kein Problem, wir haben eine Wegbeschreibung dabei: Küstenstraße rauf, an Jbeil vorbei, den militärischen Kontrollpunkt passieren und dann abbiegen Richtung Berge. Den Kontrollpunkt kennt Samara. Nur leider meint er einen anderen, wie wir erst später feststellen werden. Also heißt es in Batroun, nach dem Weg zu fragen. Nicht ein Mal fragt Samara, nicht zwei Mal, sondern ungefähr alle 200 Meter. Das ist einigermaßen anstrengend, aber später verstehen wir, dass das Ganze dennoch seine Berechtigung hat: Niemand würde hier zugeben, keine Ahnung zu haben, so dass es gilt, aus der Fülle der verschiedenen Antworten die zielführenden Informationen herauszufiltern. Schließlich geht es in Serpentinen die Berge hinauf, ab und zu ein unbefestigtes Stück Straße dazwischen.
„fi“ und „nix“: Das Weingut Clos du Phoenix liegt in den Bergen nördlich von Beirut
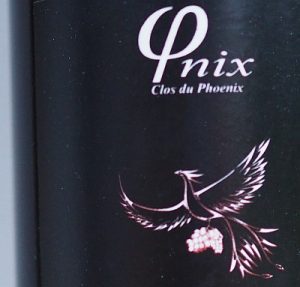
Wir sind vom vielen Kurvenfahren schon ganz eingelullt, als plötzlich ein rotes, kastenförmiges Gebäude am Straßenrand auftaucht, auf dem das griechische F – φ – und danach „nix“ zu lesen ist. Wir stutzen kurz. There it is!, rufen wir dann beinahe triumphierend dem Fahrer zu, quasi als Beweis, dass sich die heillose Kurverei doch gelohnt hat. Gut, dass wir uns vorher die Website von Clos du Phoenix angesehen haben, die kryptische Abkürzung hätten wir sonst wohl nicht unbedingt mit dem Weingut in Verbindung gebracht.
Auch drinnen wird es einem nicht unbedingt einfach gemacht. Yvan Jobard, der Oenologe, möchte nicht fotografiert werden. Noch nicht einmal von seiner eigenen Hochzeit gäbe es ein Bild von ihm, erwidert er unseren fragenden Blick. Tja dann, schade.

Während wir sprechen, schraubt Yvan immer wieder die Handpresse ein Stück weiter nach unten, der frische Rosé, der eine beeindruckende Färbung hat, fließt am Fuße des Bottichs heraus. Durch die Abpress-Methode bekäme man einfach das beste Resultat, meint der kamerascheue Kellermeister, auch wenn so der Ertrag geringer ausfalle. Dabei leidet der schon, bevor es in die Presse geht: Die Frauen aus dem Dorf pflückten häufig Weinblätter, um sie zu kochen und mit Reis und allerlei anderen Zutaten zu füllen. Eine leckere Meze – wie man im Land der Zedern die Vorspeisen nennt –, die die Trauben allerdings übel nehmen: mehr brennende Sonne genau auf der Frucht, weniger Photosynthese durch die fehlenden Blätter. Nun, zumindest den verheerenden Sandsturm bei der letzten Lese habe man glücklich umschifft, weil man gerade schon geerntet hatte.
Die ersten Trauben werden im Juli gelesen

Und dieses Jahr beginnt die Lese Mitte Juli! Wir sind ziemlich überrascht. Nun, meint Yvan, der Winter sei warm gewesen, entsprechend früh habe die Blüte eingesetzt, und das sei nun 102 Tage her – also alles ganz normal. Wir probieren den Weißwein vom Vorjahr, den einzigen, den Clos du Phoenix herstellt, eine Cuvée aus Marsanne und Chardonnay. Er hat eine florale Note, eine etwas durchdringende Frische; im Mund ist eine deutliche Säure spürbar. Uns fehlt etwas die Frucht. Ich mag keine Kaltvergärung, sagt Yvan, damit diese exotischen Fruchtnoten herauszuzaubern, das sei eine Mode, die möge er nicht.

Der Rosé aus 2015 hat ein wenig Frucht: Erdbeere und Kirsche, wenn auch mit einer etwas unreifen Note, das Ganze bei einer für einen Rosé recht deutlichen Säure. Also kommen wir zum Rotwein. Die 2011er Cuvée de la Citadelle aus Syrah, Mourvèdre und Grenache duftet fein, ist auch am Gaumen elegant, vermag allerdings in der Aromatik nicht ganz zu überzeugen. Der 2009er Syrah spricht uns deutlicher an, definiert und mit einer guten Würze sowie einem schön balancierten Tannin versehen. Syrah scheint Yvan zu mögen. Nein, die Libanesen würden den Syrah mögen. Deshalb habe er auch den Cabernet Sauvignon herausreißen und ihn durch Syrah ersetzen lassen. Wir verlassen die Kellerei und müssen erstmal die Eindrücke sortieren. Klar ist zumindest eins, hier läuft man nicht dem Mainstream hinterher. Das mit dem Syrah sei jetzt hier mal ausgeklammert.
IXSIR: Vom arabischen Wort für Elixir abgeleitetes Kellereiprojekt

Samara hat sich nicht auf direktem Wege, aber letztlich erfolgreich zur Kellerei IXSIR durchgefragt. Bei IXSIR läuft der Hase ganz anders. Erstens: Hier haben wir es nicht mit einem Familienweingut zu tun, sondern dem Objekt von zwölf Investoren. Zweitens: Die jeweiligen Trends hat man hier durchaus auf dem Schirm, was nicht heißt, dass man ihnen als Kopist hinterherläuft.
Der Weißwein und Rosé wird reduktiv ausgebaut. Damit auf dem Weg in die sauerstoffabgeschlossene Kaltvergärung nichts unkontrolliert vorvergärt, sorgt Kellermeister Gabriel Rivero dafür, dass es mit der Kühlung schon vor dem Stahltank losgeht: Im Fahrzeug, dass die 18-Kilo-Kästen in die Kellerei bringt, wo sie in einen Kühlraum verbracht werden, bevor erst am Tag danach die Auslese und danach die Pressung startet. Das Ergebnis bemerkt die Nase bereits beim Weißwein aus dem Einstiegssegment „Altitudes“: jede Menge Frucht. Dennoch ist der Weiße durchaus nicht (international) austauschbar und ebensowenig Everybodys Darling: Auch Muskat und florale Noten empfängt die Nase, im Mund ist ein Quantum Bitteres zu spüren. Auch die Auswahl der Rebsorten findet sich so nicht überall: Muscat, Sauvignon Blanc, Viognier, Sémillon und die autochthone Obeidy. Rivero, der umtriebige Spanier, der auch schon in anderen Weingütern in Spanien, Frankreich und dem Libanon gearbeitet hat, wählt die Rebsorten nach dem Standort aus – von denen IXSIR einige hat und alle zwischen 950 und 1700 Metern! -, eine Lieblingsvarietät nennt er nicht sein eigen.

Der abgepresste Rosé hat eine intensive florale Note, ein wenig, wie wenn man an einem riesigen Blütenstrauch vorbeigeht, wie es auch in Beirut immer wieder geschieht. Hier ist uns das ein wenig zu aufdringlich. Im Mund ist der Rosé dagegen harmonisch und verfügt über eine schöne, milde Säure.
Der Holzeinsatz wird gezielt gesteuert
Der Holzausbau beginnt in der nächstteureren Reihe, „Grande Réserve“. Offenbar orientiert sich Rivero hier an dem, was derzeit angesagt ist, nämlich maßvoller Holzeinsatz: Die Cuvée aus Viognier, Sauvignon Blanc und Chardonnay lässt er vier bis fünf Monate im Holzfass, was ihr eine schöne Fülle und Schmelz verleiht. Aber das heißt nicht, dass er einfach auf die Kellerei überträgt, was er für geeignete Weinbereitung hält, sondern experimentiert gegebenenfalls, bis es so wird, wie er es sich vorgestellt hat. Bei der Größe der Holzfässer hätten sich die 400-Liter-Behältnisse als am vorteilhaftesten herausgestellt gegenüber denen zu 225 und 500 Litern. Es scheint, dass hier ein Profi am Werk ist, der zwar durchaus das nötige Selbstbewusstsein hat, um die Linien festzuzurren, sich aber eben nicht über die Logik des Terroirs erhebt.

Dem Wein bekommt das sehr gut, besonders dem Rotwein, wie wir finden. Die 2011er Cuvée aus Syrah und Cabernet Sauvignon aus der mittleren Linie duftet schon super nach Garrigue und Waldboden. Auf den Punkt gereifte rote Früchte verwöhnen den Gaumen, eine tolle Ausgewogenheit und ein schöner, aber nicht übertriebener Körper sowie angenehme Tannine nehmen uns spontan für den Roten ein. Der Rote aus dem Spitzensegment EL IXSIR, selber Jahrgang, sendet noch etwas dunklere Noten, nach Leder und Tabak, in die Nase; im Mund kommt Kirsche zum Vorschein sowie ein Quantum Säure, damit es nicht zu undefiniert wird. Der Wein ist wunderbar rund und hat einen tollen Nachhall.
Im Libanon Weingüter am Straßenrand bewerben

Was it good?, fragt Samara, als wir wieder in seinen Nissan einsteigen. Ja, war es! Der Verkehr zurück nach Beirut ist wieder heftig, aber immerhin fahren wir antizyklisch. Traffic jam!, bemerkt Samara mehrmals mit Blick auf die Gegenfahrbahn, sichtlich erfreut. Wir zählen die Plakate der Kampagne „Summer excuses“ von Château Ksara, die neben der Autobahn prangen. Offensichtlich sind im Libanon Weingüter und Wein ein Thema, allemal im christlich geprägten Teil des Landes. Als wir irgendwann die Plakate ungezählt vorbeiziehen lassen, weil es so viele sind, geht es auf Virgin Radio Lebanon, das Samara eingeschaltet hat, weiter: Give us a call and tell your summer excuse! Nun, unsere ist leider ziemlich wahr: Stuck in traffic.